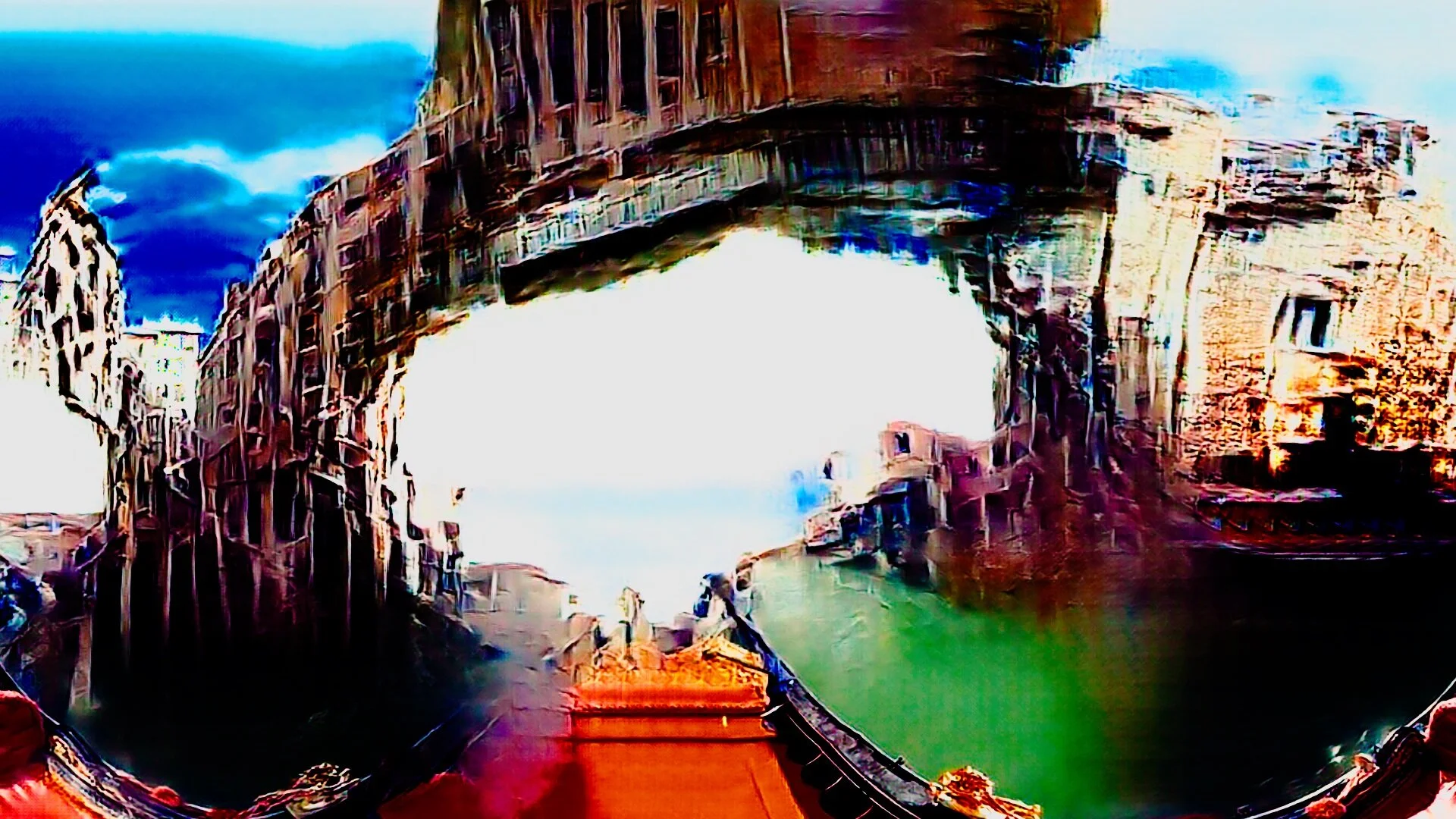Die Künstlerin ist abwesend
Autorin:
Sepideh HonarbachtIllustration:
Evgeniy Shvets/Stocksy
Konzeptkunst der 1960er Jahre hat ein paar Ausstellungsansätze hervorgebracht, die wir uns noch einmal genauer anschauen sollten.
Zwischen den beiden Lockdowns in diesem Jahr hatte ich Gelegenheit, die neuen Räume der Haubrok Foundation am Strausberger Platz in Berlin-Friedrichshain zu besuchen. Das aus dem Rheinland stammende Ehepaar Barbara und Axel Haubrok sammelt seit 1988 zeitgenössische Kunst – mit besonderem Schwerpunkt auf Konzeptkunst. Die Geister streiten sich darüber, ob das überhaupt Kunst ist – oder nicht eher eine Geste – und was damit genau gemeint ist. „Die ganze konzeptionelle Kunst zeigt nur auf Dinge“, sagte mal der Maler Al Held. Tony Godfrey, Autor und Kurator, hat es sinngemäß so zusammengefasst: Konzeptionelle Kunst beschäftigt sich nicht mit Formen und Materialien, sondern mit Ideen und Bedeutungen. Er hat vier Erscheinungsformen identifiziert:
Readymade à la Marcel Duchamp
eine Intervention, die Bilder, Texte und Gegenstände in einen überraschenden Kontext bringt
eine Dokumentation, bei der das eigentliche Werk nur durch Notizen, Karten oder Fotos sichtbar wird, oder
Wörter, die das Konzept lediglich sprachlich-typografisch darstellen.
Die Ausstellung „during the exhibition“, kuratiert von Axel Haubrok und seinem Sohn Konstantin, fällt in die dritte Kategorie und interessierte mich aus drei Gründen. Erstens: Konzepte sind der Kern meiner Arbeit. Zweitens: Wie präsentiert man Konzepte vergangener Ausstellungen so, dass der Besucher sie versteht? Drittens: Zugegebenermaßen wollte ich auch die Räume am Strausberger Platz sehen. Eine ehemalige Wohnung, zwei Zimmer plus Küche (die auch als Ausstellungsraum genutzt wird). Sie befindet sich in einem monumentalen Gebäudekomplex aus den 1950er Jahren an der Karl-Marx-Allee, der vom Architekten Hermann Henselmann geprägt wurde. Dieser markante, mit der Geschichte der DDR eng verbundene Ort ist auch ein Schauplatz in Jonathan Franzens Unschuld. Lieblingsroman, Lieblingsschriftsteller.
Den Strausberger Platz erreiche ich von meinem Zuhause in Berlin aus in sieben Minuten mit dem Rad. Über einen Seiteneingang geht es mit dem Aufzug in den vierten Stock. Es riecht muffig, wie häufig in so alten Gebäuden, selbst wenn sie modernisiert sind, das Licht ist ockerfarben. Und irgendwie erwarte ich, dass Männer in Regenmänteln mit ledernen Aktentaschen gleich um die Ecke kommen und mich fragen, was ich hier zu suchen habe. Tun sie natürlich nicht. Die Tür zu den Räumen steht offen, Stimmen dringen aus dem Inneren heraus. Ich habe mich für ein Zeitfenster angemeldet. Ich werde von einer freundlichen Dame empfangen, die mich mit einem über mehrere Seiten eng bedruckten Dokumentation ausstattet und einlässt. Ich wende mich zunächst nach rechts.
Die bodentiefen Fenster des kleinen, mit altem Fischgrätparkett ausgelegten Salons stehen offen am diesem milden Septembertag und geben den Blick frei auf grüne Baumwipfel. Im Raum stehen hohe Glastische, darauf liegen überwiegend Dokumente und mit Schreibmaschinenschrift bedruckte weiße Karten. In einer Ecke steht eine Stereoanlage, die eine Tonaufnahme abspielt. Ich hatte es mir weitläufiger vorgestellt, alles in allem dürfte die Fläche vielleicht 60 Quadratmeter groß sein. Trotzdem komme ich mir ersten Moment verloren vor, weiß nicht, wie ich mich orientieren soll.
Ich habe Glück, Axel Haubrok ist vor Ort und führt mich erzählerisch durch die Ausstellung. Zu jeder Karte, jedem Dokument kennt er die Geschichte. Zum Beispiel zur titelgebenden Arbeit von Robert Barry „closed gallery“. Barry lud Ende der 1960er Jahre zu Ausstellungen ein, die für das Publikum nicht zugänglich waren. Haubrok schwärmt von dem bisher nicht realisierten „Konzept für ein Buch als Ausstellungsort“ (1978) von Barbara Schmidt-Heins. Hans Ulrich Obrist hingegen hat seine Ausstellung umgesetzt. Er bat Künstler wie Ed Ruscha, Maurizio Cattelan, Gilbert & George, Isa Genzken und Gerhard Richter, für ihn Postkarten zu entwerfen, und stellte sie 1993 in einem Hotelzimmer in Paris aus, in dem er auch gerade wohnte – und zwar ohne um Erlaubnis zu fragen. „Hôtel Carlton Palace. Chambre 763“ war der Titel der Ausstellung und der Dokumentation. Herrliche Idee. Die reproduzierten Karten sind in den Räumen der Haubrok Foundation zu sehen.
Während ich Haubrok zuhöre, denke ich: An diesem Ort gibt es einiges, das wir lernen können für Ausstellungen, die permanent davon bedroht sind, verschoben, abgesagt und in den virtuellen Raum verlagert zu werden. Es gibt keine Vernissage, keine Finissage, Künstler sind dazu verdammt, ihrem eigenen Eröffnungsevent fernzubleiben. Sofern das Publikum eingelassen wird in Galerien, muss es Masken tragen, die Hände desinfizieren und natürlich möglichst nichts anfassen. In vielen Museen gab es, solange sie geöffnet hatten, keine Führungen, man musste sich selbst zurechtfinden. Das Erlebnis ist eingeschränkt oder findet gar nicht statt, nach Barrys Motto: „During the exhibition the gallery is closed“. Ich hoffe sehr, nicht mehr für lange.
„Wertvoll ist nicht nur das, was wir sehen und mitnehmen können, sondern auch das Flüchtige, das wir erleben.
Folgende Erkenntnisse habe ich für künftige Ausstellungen mitgenommen:
1. Physisches Erleben bleibt die Kür: Ja, man kann Ideen und sogar philosophische Fragen visualisieren. Je komplexer das Thema, desto wichtiger, dass eine Ausstellung alle Sinne anspricht. Dass ich durch einen Raum gehen, mir Dinge anschauen und auch mal wieder zu einem beliebigen Exponat zurückkehren und die Maße in Relation setzen kann, hilft mir zu begreifen. Vieles kann man online anschauen, aber ohne die räumliche Dimension ist es nur das halbe Vergnügen. Und – ich finde es interessant zu sehen, wie andere auf die Exponate reagieren, zu hören, was sie miteinander sprechen.
2. Menschen machen den Unterschied: Ausstellungen, die Fragen aufwerfen, Zusammenhänge aufzeigen und auf kritische Aspekte hinweisen wollen, erklären sich in der Regel nicht von selbst. Selbst mit noch so guter Didaktik und technischen Hilfsmitteln wie Audio Guides und ausgegeben Touchpads, die ich vor mir hertragen kann. Als Besucherin nehme ich am meisten mit, wenn jemand da ist, der mir etwas erklärt und den ich auch etwas fragen kann. Ein Hoch auf die wissenden, engagierten und häufig unterhaltsamen Guides! Ich habe in den vergangenen Jahren in Museen, Stiftungen, Galerien und auch bei Unternehmensausstellungen viel von ihnen gelernt. Sie sind für mich systemrelevant.
3. Dokumentation ist essenziell: Ohne einen Katalog oder eine andere Form der Dokumentation, wie das Sammeln von Einladungskarten, Briefen und Fotos, gingen viele konzeptuelle Ausstellungen der Nachwelt verloren. Mancher Künstler mag das ephemere Erlebnis beabsichtigen. Aber aus Sicht des Publikums und unserer Zielgruppen kann ein Katalog oder eine Website eine Bereicherung sein und sollte als Teil des Konzepts verstanden werden. Für viele Künstler gehören das Werk und die Publikation ohnehin zusammen. So sollte es sein.
4. Dada funktioniert nicht mehr: Abweichungen von Konventionen erleben wir aktuell ständig. Manche erscheinen uns gar sinnlos. Aktuell fände es niemand wirklich lustig, wenn plötzlich das Licht in der Ausstellung ausginge oder die Türen der Galerie für das Publikum verschlossen blieben. Überraschendes und Unerwartetes können wir eher schaffen, indem sich die Ausstellung verändert, nicht statisch ist. Gern unter Mitwirkung der Besucher.
5. Co-Kuration ist das Zauberwort. So hat es 1995 schon der „strenge Kurator“ Otto Kobalek gemacht, dokumentiert in einer Videoarbeit von Franz West und Hans Weigand, die ebenfalls in „during the exhibition“ bei Haubrok zu sehen ist. Zur Eröffnung der Ausstellung „Sammlung West“ hing noch kein einziges Bild an der Wand. Gemeinsam mit den Besuchern entschied Kobalek vor Ort, welches Werk wohin gehängt wird. Übrigens erinnert mich dies an das bemerkenswerte Co-Kurationsprojekt, das das NRW-Forum Mitte dieses Jahres unter der Leitung ihres künstlerischen Direktors, Alain Bieber, mit nextmuseum.io gestartet hat, bei dem Interessierte sich über den Social-Media-Kanal Telegram Vorschläge einbringen und Kunstwerke hochladen konnte. Die Ausstellung dazu wird im Februar 2021 in Düsseldorf zu sehen sein. Darüber später mehr.
6. Und ewig lockt das Format: Am spannendsten finde ich die Frage, wo und wie Konzepte gezeigt werden können. In dem Maße, wie sich Städte verändern und Flächen frei werden, können die Antworten darauf immer wieder anders ausfallen. Aber warum nicht scheinbar exotische Orte für Ausstellungen öffnen? Einen Friseursalon, um Haarkunst zu zeigen? Eine Herrentoilette, um Gewalt gegen Frauen zu thematisieren? Oder das Konzept – die philosophische Frage – einfach in einem Schuhkarton verpackt an 1.000 Rezipienten senden, die ihrerseits einen Impuls einbringen und den Karton dann weitersenden an die nächsten tausend – ja, was? Besucher passt nicht mehr. Die Menschen kommen nicht in die Ausstellungen, sondern die Ausstellung kommt zu ihnen nach Hause. So eine Art metamorphe Ketteninszenierung.J
Spannende Zeiten stehen uns bevor, in denen wir vieles neu denken und ausprobieren können – und müssen. Vielleicht gibt es dafür in ein paar Jahren sogar eine ganz neue Begriffswelt, weil „der/die“ Künstler*in, „die“ Ausstellung und „den/die“ Besucher*in im tradierten Sinne nicht mehr trifft. Die Grenzen sind fließend.
Zu Besuch bei den Erzählern
Ich empfehle, sobald wieder möglich, einen Termin auszumachen und sich durch die Räume führen zu lassen von Axel oder Konstantin Haubrok. Und ganz eigene Impulse mitzunehmen.
Haubrok Foundation
Strausberger Platz 19
Seiteneingang, 4. Stock
10243 Berlin